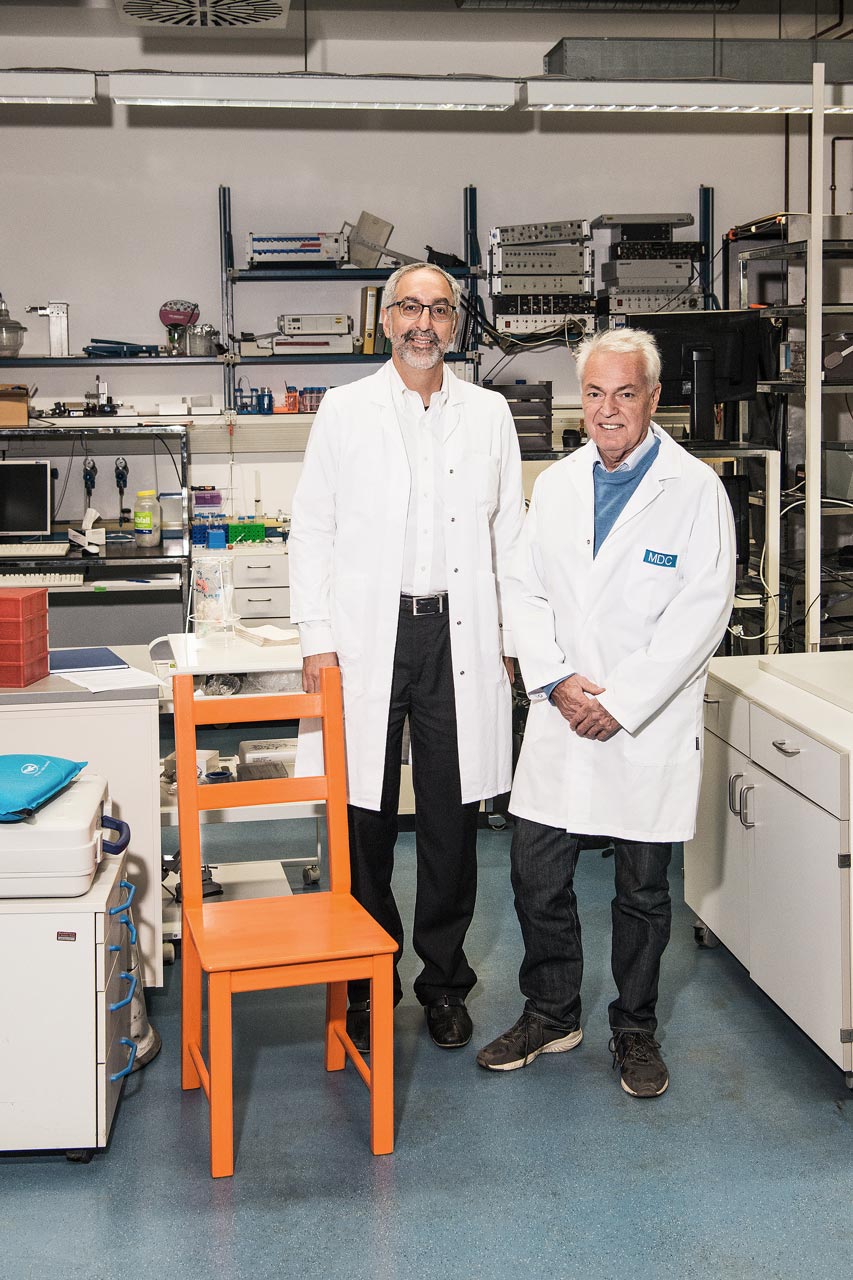Transatlantische Forschung zu den Steuerungseinheiten des Gehirns
Wenn sich ein US-amerikanischer Mediziner aus der patientenorientierten, translationalen Forschung und ein deutscher Grundlagenforscher treffen, kann diese Begegnung viele Wendungen nehmen. Im Falle von Professor David Gutmann und Professor Helmut Kettenmann führte sie zum Zusammenwachsen ihrer beiden Arbeitsgruppen. Welche Bedingungen für eine erfolgreiche transatlantische Zusammenarbeit gegeben sein müssen und was daraus entstehen kann, haben die beiden uns in einem Interview berichtet.
Professor Gutmann, Sie sind jetzt bereits das dritte Mal als Einstein BIH Visiting Fellow für eine längere Zeit in Berlin. Welchen Eindruck macht die Stadt auf Sie?
Gutmann: Nach jedem Aufenthalt in Berlin fällt es mir schwer, zurück nach Hause zu fahren. Hier gibt es so viel zu tun. Berlin hat vieles richtig gemacht, angefangen beim öffentlichen Verkehr bis hin zum kulinarischen und kulturellen Angebot. Wir können von unserer Haustür in Mitte direkt ins Stadtleben eintauchen, dort gibt es unzählige Cafés, Konzerthäuser, Museen und Galerien.
Wie kamen Sie beide auf die Idee, zusammen ein Projekt in die Wege zu leiten?
Gutmann: Professor Kettenmann ist einer der Pioniere in der Forschung über Gliazellen, einem unterstützenden Zelltyp im Gehirn. Ich verfolgte seine Arbeit seit vielen Jahren, aber das erste Mal persönlich trafen wir uns bei einem Symposium zu Gehirntumoren am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Meine Arbeitsgruppe definiert seit 25 Jahren die molekularen Mechanismen hinter einer Krankheit, die verschiedene Defizite des Nervensystems zur Folge hat: Neurofibromatose Typ 1 – NF1. Wir fanden heraus, dass eine Unterkategorie der Gliazellen mit dem Namen Mikroglia einen Einfluss darauf hat, wie sich Erkrankungen des Gehirns bei Patienten mit NF1 entwickeln, insbesondere Tumore, die bei Kindern auftreten. Wir haben auf diesem Gebiet viele Fortschritte gemacht und ich wollte dieses Forschungsgebiet erweitern. Die Förderung durch die Stiftung Charité bot mir die Möglichkeit, an den Ort zu kommen, der für seine bahnbrechende Forschung zu Gliazellen weltweit bekannt ist. Zusammen untersuchen wir nun, wie NF1-Mutationen die Biologie der Mikroglia bei Mäusen und Menschen in Hinblick auf die normale Gehirnfunktion beeinflussen.
Kettenmann: Hinzu kommt, dass ich als Biologe keine formale medizinische Ausbildung erhalten habe, wohingegen David immer noch aktiven Kontakt zu Patienten mit NF1 hat. Das macht die Zusammenarbeit umso spannender für beide Seiten.
Wie viel Zeit verbringen Sie denn noch in der Klinik?
Gutmann: Ich verbringe in der Regel 75 Prozent meiner Zeit im Labor. Allerdings sind meine Patienten die Motivation hinter meiner Forschung. Die interessantesten Fragestellungen begegnen mir, wenn ich Kinder mit NF1 behandle. Doch nur durch Grundlagenforschung im Labor lassen sie diese Probleme lösen.

Förderprogramm
Einstein BIH Visiting Fellows
Förderzeitraum
2017 bis 2020
Vorhaben
Biologie und Behandlungsstrategien von niedriggradigen Gliomen
Fachgebiet
Zellbiologie
Institution
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC)
2017
Humboldt-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung
Seit 2015
Stellvertretender Präsident für Forschung, Neurologie an der Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
Seit 2001
Professur, Institut für Neurologie, Pädiatrie und Genetik an der Washington University School of Medicine, St. Louis, USA
Kettenmann: Eine unserer Techniken, um Mikroglia herzustellen, sind sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen. Dafür hat Professor Gutmann Haut- und Urinproben der Patienten gesammelt und die Zellen zu Stammzellen reprogrammiert. Dann können sie sich wieder in alle mögliche Zelltypen entwickeln, im unserem Fall in Mikroglia. Anders kommt man nicht an menschliches Material. Mithilfe dieser Technik wollen wir normale Zellen und Zellen mit NF1-Mutationen vergleichen. Jedes Individuum mit NF1 wurde mit einer Mutation in einer Kopie des NF1-Gens geboren.
Was sprach dafür, das Projekt in Berlin und nicht in den USA durchzuführen?
Kettenmann: Die Fördermöglichkeiten hier sind einzigartig. Das Projekt wurde durch die Stiftung Charité mit den Mitteln von Johanna Quandt ermöglicht. In den USA gibt es nichts Vergleichbares, um ausländische Wissenschaftler für längere Forschungsaufenthalte zu gewinnen. Selbst in Europa erscheint mir das einzigartig.
Wie gestaltet sich die Arbeitsaufteilung in Ihrem Projekt konkret?
Kettenmann: Für die Studierenden ist es interessant, gleichzeitig von zwei Forschern mit vollkommen unterschiedlichen Hintergründen betreut zu werden: Einer aus der Grundlagenforschung in Deutschland, der andere aus der klinischen Forschung in den USA. Professor Gutmann setzt die Idee hinter den Einstein BIH Visiting Fellows perfekt um. Er ist nun zum dritten Mal für zwei Monate hier und hat für die Studierenden immer ein offenes Ohr.Gutmann: Wenn ich nicht vor Ort bin, haben wir Teammeetings über Skype. So können unsere Arbeitsgruppen interagieren. Außerdem tauschen sie regelmäßig Versuchsprotokolle aus.
Wir sind gut darin, induzierte pluripotente Stammzellen herzustellen. Gleichzeitig haben wir von Professor Kettenmanns Arbeitsgruppe einiges über die Analyse von Mikroglia gelernt. Dieser Austausch bereichert unsere Forschung enorm. Das Labor hier ist sehr offen und Professor Kettenmann ist ein großartiger Gastgeber.
Glauben Sie, dass das Ihre Studierenden motiviert, selbst über eine internationale Karriere nachzudenken?
Gutmann: Das Einstein BIH Visiting Fellows-Programm hat bereits einzigartige Möglichkeiten zur internationalen Kollaboration und Ausbildung geschaffen. Beispielsweise ist ein Postdoktorand, der im Kettenmann Lab ausgebildet wurde, nun als Fellow zu uns gekommen. Das ist die erste erfolgreiche transatlantische Transplantation, die wir erreicht haben (lacht).
Wie hat sich die Forschung auf dem Gebiet verändert, wenn Sie an Ihre Zeit als Doktorand zurückblicken?
Gutmann: Als Doktorand hatte ich das Gefühl, durch die Fähigkeiten und Techniken des Labors, in dem ich ausgebildet wurde, eingeschränkt zu sein. Alles verlangte große Mühen, Sequenzieren war ein Vollzeitjob. Ich glaube, dass junge Menschen in der Forschung heute weniger daran gebunden sind, was ihre Betreuer gut können oder was im jeweiligen Labor verfügbar ist. Mit Core Facilities können technologische Hindernisse überwunden und mehr Fragen beantwortet werden. In den 1990er Jahren musste eine Postdoktorandin bei uns im Labor 18 Monate an der Herstellung unserer ersten gentechnisch veränderten Maus arbeiten. Eine Core Facility kann das in drei bis vier Monaten bewerkstelligen. Junge Wissenschaftler können daher durchaus über den Tellerrand schauen.
Gibt es Momente, in denen Sie vollkommen unerwartete Ergebnisse erhalten?
Gutmann: Ich wäre enttäuscht, wenn meine Daten immer nur meine Erwartungen bestätigten. Das ist keine Wissenschaft. Mit unerwarteten Ergebnissen konfrontiert zu werden, bedeutet oft, eine interessante Richtung ausprobieren und einschlagen zu können. Jedes Mal, wenn man eine Hypothese ablehnt, gibt es eine neue Hypothese, der man nachgehen kann.
Kettenmann: Sowohl bei den Maus- als auch bei den menschlichen Modellen waren wir zum Beispiel sehr überrascht, dass es große Unterschiede zwischen den Mikrogliazellen von männlichen und weiblichen Individuen gibt.
Was bedeutet das für die Patienten?
Gutmann: Diese Erkenntnis kann eine neue Ära der verbesserten Risikobewertung in der Klinik einläuten. Mit einem besseren Verständnis der Risikofaktoren für solche Erkrankungen, werden wir in der Lage sein, auf personalisierten Informationen basierende Behandlungen zur Verfügung zu stellen.
Finden Sie, dass die Öffentlichkeit gut über neurologische Erkrankungen aufgeklärt ist?
Gutmann: In den USA, aber auch in anderen Ländern, gibt es mitunter öffentliches Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Um transparenter zu arbeiten und unsere spannende Forschung mit der Öffentlichkeit zu teilen, müssen wir unsere Türen öffnen. Das ist enorm wichtig, immerhin finanzieren Steuerzahler den Großteil der Forschung. Wenn sie uns nicht vertrauen, wird dort als erstes gespart. Das können wir uns nicht leisten. In unserem NF-Zentrum in St. Louis versuchen wir, Familien durch Newsletter, Laborbesichtigungen und Diskussionen in der Klinik zu informieren. Familien, für die zurzeit wenige Therapieoptionen bestehen, gewinnen neue Hoffnung, wenn sie sehen, an was wir momentan im Labor arbeiten.
Kettenmann: Es gibt einige Initiativen, um Forschung zugänglicher zu machen. Das Gläserne Labor am MDC, in dem neue wissenschaftliche Entdeckungen für Schulgruppen aufbereitet werden, ist ständig ausgebucht. Detlev Ganten hat vor vielen Jahren die Lange Nacht der Wissenschaft initiiert. Zusätzlich haben wir mit Unterstützung der Hertie-Stiftung die Webseite dasgehirn.info gegründet, die sehr anschaulich das Gehirn erklärt.
Wie bekannt sind die Funktionen der Gliazellen?
Kettenmann: In den über 40 Jahren, die ich in diesem Gebiet tätig bin, haben wir bereits einiges erreicht. Wenn ich mir allerdings anschaue, wie viele Menschen an Neuronen forschen, sind wir noch eine kleine Community. Und das, obwohl die Hälfte aller Zellen im Gehirn Gliazellen sind. Immerhin ist heute jedem Neurowissenschaftler bewusst, dass wir das Gehirn nicht verstehen werden, ohne jene Zellpopulationen zu begreifen, die das Gehirn kontrollieren und steuern.
Oktober 2018 / MM